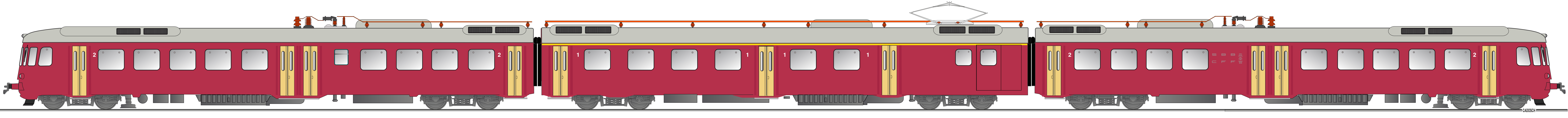SBB Vorortstriebzug RABDe 12/12
“Die Mirage für den Zürcher Vorortsverkher“

RABDe 12/12 1103 als Regionalzug nach Zürich in Rapperswil um 1983
Rapperswil, die Rosenstadt am Zürichsee im Kanton St. Gallen, hätte für mich wohl nie eine so grosse Bedeutung gehabt, wäre da nicht der Kinderzoo vom Zirkus Knie gewesen. Keine Sommerferien in den 70er meiner Kindheit ohne einen Ausflug nach Rapperswil. Meistens begann der Ausflug mit einer zweistündigen Schifffahrt auf dem Zürichsee nach Rapperswil, dann der Besuch im Kinderzoo und anschliessend die Rückfahrt mit dem Zug nach Zürich im RABDe 12/12 – der „Mirage“.
Der Führerstand war nur durch eine Türe und eine Glasscheibe vom Fahrgastraum getrennt, und so konnte man dem Lokführer über die Schultern schauen. Und meistens – herzlichen Dank an die lieben SBB-Lokführer der Depots Rapperswil und Zürich – durfte man, wenn man lieb fragte, auf der Sitzbank im Führerstand direkt neben dem Lokführer Platz nehmen. Manchmal öffneten die Lokführer die Türe sogar schon, bevor man die Frage überhaupt gestellt hatte. Dann ging es in rascher Fahrt der Goldküste entlang zurück nach Zürich – damals noch ab Stadelhofen durch den Lettentunnel und über den Lettenviadukt in den Zürcher Hauptbahnhof.
Die fast schon geliebten RABDe-12/12-Triebzüge waren die Antwort der SBB auf ein sehr konkretes Problem: Der Vorortsverkehr am rechten Zürichseeufer war in den 1950er- und 1960er-Jahren schlicht an seine Grenzen gekommen. Die 36 Kilometer lange, eingleisige Strecke Zürich–Meilen–Rapperswil (Goldküstenlinie) wies einen ausgeprägten Pendlerverkehr mit hohen Spitzen auf. Die baulichen Anlagen waren ungenügend, die vielen Zugskreuzungen führten zu langen Fahrzeiten und verspätungsanfälligen Fahrplänen. Teilweise dauerte die Fahrt Zürich–Rapperswil bis zu 83 Minuten – ein Wert, der weder betriebswirtschaftlich noch für die Kundschaft akzeptabel war. Ein vollständiger Ausbau der ganzen Strecke auf Doppelspur wäre aus Sicht der SBB die eleganteste Lösung gewesen, scheiterte aber an Kosten, Platzproblemen und heiklen Abschnitten beim Landerwerb und bei Kunstbauten entlang des Seeufers. Man suchte daher nach einer Lösung, die mit vergleichsweise moderatem baulichem Aufwand eine spürbare Verbesserung bringen würde.
Der Schlüssel lag in einem neuen Betriebskonzept: ein starrer 30-Minuten-Takt auf der ganzen Strecke, verkürzte Fahrzeiten und möglichst wenig Rollmaterial – kombiniert mit gezielten Doppelspurabschnitten nur dort, wo Zugskreuzungen im Fahrplanschema fix stattfinden sollten. Dafür benötigte man leistungsfähiges Rollmaterial, das diese Anforderungen erfüllen konnte: schnell beschleunigen, kräftig elektrisch bremsen, kurze Haltezeiten – und das alles ohne Komforteinbussen für die Fahrgäste. Aus diesen Überlegungen entstand ein speziell für den Vorortsverkehr dimensionierter Triebzug mit Allachsantrieb – der RABDe 12/12.
Entstehung und Konzeption
Pro Einheit waren rund 200 Sitzplätze und ein kleiner Gepäckraum vorgesehen. Durch eine niedrige Fussbodenhöhe und deutlich mehr Türen als bei den üblichen Einheitswagen sollte das Ein- und Aussteigen beschleunigt und die Haltezeiten deutlich reduziert werden. Gleichzeitig musste der Zug in der Lage sein, im dichten Pendlerverkehr mit vielen Zwischenhalten gegenüber konventionellen Zügen eine deutlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit zu erreichen. Dafür brauchte es eine hohe installierte Leistung, eine leistungsfähige elektrische Bremse und eine ausgeklügelte Steuerung.
1957 schrieb die SBB einen Konstruktionswettbewerb für einen solchen Vororttriebzug aus. 1958 erhielt die Schindler Waggon AG in Pratteln (SWP) den Auftrag für die Gesamtkonzeption des wagenbaulichen Teils sowie für Drehgestelle und Endwagen. Die Mittelwagenkästen wurden von den Flug- und Fahrzeugwerken Altenrhein (FFA) gefertigt. Die elektrische Ausrüstung – vom Transformator bis zur komplexen Steuerung – kam von den Ateliers de Sécheron (SAAS) in Genf, während Brown, Boveri & Cie. (BBC) die Fahrmotoren und den Federantrieb lieferte.
Nach weiteren Abklärungen bewilligte der SBB-Verwaltungsrat im Juli 1963 einen Kredit von 57 Millionen Franken für 20 Dreiwagenzüge der neuen Bauart RABDe 12/12 mit den Nummern 1101–1120.
Aufbau und Innenraum
Der RABDe 12/12 war ein fest gekuppelter Dreiwagenzug, bestehend aus zwei identischen Endwagen und einem Mittelwagen. Über Kurzkupplungen sind die Wagen zu einer betrieblich untrennbaren Einheit verbunden. Die Gesamtlänge über die Kupplungsebenen beträgt rund 73,3 Meter, das Dienstgewicht etwa 170 Tonnen. Die Übergänge zwischen den Wagen sind mit Gummiwulst und einer dreiteiligen Übergangsbrücke abgedeckt, so dass der Innenraum durchgehend und stufenlos ist. Zwischen den Führerstandsrückwänden verläuft der Wagenboden ohne Rampen oder Stufen – ein bemerkenswert moderner Ansatz für die damalige Zeit.
Jeder Endwagen beherbergt einen Führerstand mit der Mitfahrersitzbank, drei Einstiegplattformen mit je mehreren Türen pro Seite und zwei Abteile 2. Klasse mit insgesamt 72 Sitzplätzen. Der Mittelwagen enthält zwei Abteile 1. Klasse mit zusammen 56 Sitzplätzen, drei Einstiegplattformen mit je einer Tür pro Seite sowie einen kleinen Gepäckraum.
Die hohe Türdichte war ein bewusstes Gestaltungsmerkmal: Pro 18 Sitzplätze in der 2. Klasse und 19 Sitzplätze in der 1. Klasse steht eine Einstiegstür zur Verfügung – mehr als doppelt so viele Türen wie bei einem konventionellen Einheitswagen. Damit sollten die Haltezeiten im dichten Vorortsverkehr möglichst kurz gehalten werden.
Die Innenraumgestaltung lehnt sich an die Einheitswagen I an, nutzt aber modernere Materialien: Seitenwände mit Kunststoffplatten, farblich differenzierte Polsterstoffe für Raucher/Nichtraucher und eine 2+2-Bestuhlung in der 1. Klasse. Im Bereich der Einstiegsplattformen wurden viele Handläufe installiert, um dem hohen Stehplatzanteil zur Hauptverkehrszeit gerecht zu werden.
Die Türen entsprechen konstruktiv den EW-Türen und werden vom Lokführer elektro-pneumatisch geschlossen. Die dreiteilige Führerstandsfront weist keine Stirntüren auf – Fahrgastzirkulation zwischen zwei gekuppelten Einheiten war bei Mehrfachtraktion nicht vorgesehen.
An den Stirnseiten sind automatische GF-Kupplungen montiert. Sie stellen nicht nur die mechanische Verbindung her, sondern kuppeln auch Luftleitungen und Vielfachsteuerleitungen. Neben der Mittelkupplung sitzen Hilfspuffer, damit Stösse durch Fahrzeuge mit konventioneller Schraubenkupplung nicht direkt in den Wagenkasten laufen.
Laufwerk und Antrieb
Herzstück der guten Laufeigenschaften sind die sechs zweiachsigen Drehgestelle, die – abgesehen von wenigen Anbauteilen wie z. B. den Zugsicherungsmagneten – weitgehend einheitlich konstruiert sind. Die Enddrehgestelle tragen zusätzlich Einrichtungen für die Handbremse und teilweise Spurkranzschmierung.
Der Wagenkasten stützt sich über einen Wiegenträger mit Schraubenfedern auf den Drehgestellrahmen ab, der seinerseits über Primärfedern auf den Achslagern ruht. Achslagerführung, Schraubenfedern und zusätzliche hydraulische Dämpfer sorgen für gute Seiten- und Laufstabilität – eine wichtige Voraussetzung für den Komfort bei häufigen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen.
Die Achslager waren mit doppelreihigen Pendelrollenlagern ausgerüstet, zwischen Achslagergehäuse und Rahmen gibt es keine direkte metallische Verbindung, stattdessen Gummi- und Öldämpfungselemente. Das senkte die Fahrgeräusche. Die Radsätze wiesen Radreifen mit einem Durchmesser von 850 mm im Neuzustand auf, die auf 780 mm abgenutzt werden konnten. Das speziell gewählte Spurkranzprofil mit höherem Spurkranz berücksichtigte die kleine Raddimension und die betrieblichen Sicherheitsanforderungen.
Besonders charakteristisch war der Einzelachsantrieb mit Brown-Boveri-Federantrieb. In jedem Drehgestell war der Fahrmotor quer im Rahmen gelagert und trieb über ein schrägverzahntes Getriebe einen Hohlwellenstummel an. Über Federpakete und einen Mitnehmer werden Drehmoment und Zugkraft auf die Achswelle übertragen. Der Hohlwellenstummel ist gegenüber dem Radsatz gefedert, wodurch die ungefederten Massen niedrig bleiben und die Laufruhe verbessert wird.
Alle zwölf Achsen des Zuges waren angetrieben – daher die Bezeichnung 12/12. Diese vollmotorisierte Ausrüstung verbessert sowohl die Adhäsion beim Anfahren als auch die Bremswirkung bei rekuperativem Bremsen erheblich.
Bremse und pneumatische Ausrüstung
Der Triebzug verfügt über eine umfassende pneumatische Anlage, gespeist durch einen unter dem Mittelwagen montierten Kolbenkompressor mit einer Förderleistung von etwa 1 m³/min bei 10 bar. Die Druckluft speist die automatische Bremse, die EP-Bremse, eine Rangierbremse auf dem bedienten Endwagen, die Türschliessung, Stromabnehmer, Hauptschalter, Pfeife, Scheibenwischer, Rückspiegel und verschiedene elektro-pneumatisch gesteuerte Schaltorgane. Die Bedienungselemente der Luftanlage sind in jedem Wagen auf übersichtlichen Tafeln zusammengefasst.
Die automatische Bremse wird mit einem Oerlikon-Führerbremsventil FV 3b bedient und erlaubt eine fein abgestufte Lösewirkung. Ergänzt wird sie durch eine elektropneumatische Bremse, die normalerweise über die Geschwindigkeitssteuerung angesteuert wird, bei Bedarf aber auch direkt über den Fahrschalter zur Schnellbremsung ausgelöst werden kann.
In den Drehgestellen wirkt je ein 8-Zoll-Bremszylinder pro Rad auf geteilte Bremsklötze, ein Gestängeregler (Stoppex) hält den Bremszylinderhub trotz Klotzverschleiss praktisch konstant. Der maximale Klotzdruck summiert sich auf etwa 90 Tonnen für den gesamten Zug. Als Bremsklotzmaterial kamen K-Sohlen aus Kunststoff zum Einsatz. Ihr Vorteil liegt in einem weitgehend geschwindigkeitsunabhängigen Reibwert, geringeren Geräuschen und deutlich längerer Lebensdauer gegenüber Gussklötzen. Damit konnte auf eine zweistufige R-Bremse verzichtet werden. Gleichzeitig zeigte sich im Betrieb, dass bei feuchter Witterung und geringer spezifischer Pressung gelegentlich Schäden an den Bandagen auftreten konnten, insbesondere an Achsen mit Handbremswirkung. Ihr Nachteil, die Kunststoff Sohlen entwickelten trotz starker E Bremse eine grosse Wärme dass die Bremsen oft zu Rauchen begannen - mit entsprechender Geruchsentwicklung - Typisch Mirage.
Die Enddrehgestelle verfügen zusätzlich über eine Gleitschutzanlage, die bei beginnendem Blockieren die Bremszylinder kurz entlüftet und damit Flachstellen verhindert.
Für die vielen Bremsungen im kurzen Abstand – typisch für den Vorortsverkehr – wäre eine reine Klotzbremse thermisch überlastet. Deshalb ist die elektrische Rekuperationsbremse zentraler Bestandteil des Konzepts: Sie nimmt bei mittleren und höheren Geschwindigkeiten den Hauptteil der Bremsarbeit auf, speist die Energie in die Fahrleitung zurück und entlastet so Räder und Bremsklötze. Die Druckluftbremse übernimmt das Ausbremsen bis zum Stillstand und ergänzt bei schlechter Fahrleitungsqualität oder geringen Geschwindigkeiten.
Elektrische Ausrüstung und Steuerung
Leistungsmässig wurde der RABDe 12/12 darauf ausgelegt, die 36 km zwischen Zürich und Rapperswil mit 16 Anfahrten und Bremsungen in rund 40 Minuten reiner Fahrzeit zu bewältigen. Das Pflichtenheft verlangte mittlere Beschleunigungen um 0,7–0,8 m/s² bis etwa 85–90 km/h. Die daraus resultierende Stundenleistung am Rad liegt bei rund 3300 PS – für einen Vorortzug der 1960er-Jahre ein beachtlicher Wert.
Anfänglich wiesen die Züge sogar eine Beschleunigung von bis zu 1,2 m/s² auf – dieser Wert musste nach unten angepasst werden, da die hohen Anfahrbeschleunigungen für die Reisenden unangenehm waren.
Elektrisch ist der Dreiwagenzug in zwei symmetrische Hälften gegliedert, die sich in der Mitte des Mittelwagens „treffen“. Es gibt nur einen Stromabnehmer, montiert über dem Gepäckabteil des Mittelwagens. Von dort führt eine Dachleitung zu je einem Druckluft-Hauptschalter unter den Endwagen, der den zugehörigen Transformator speist.
Jeder Transformator verfügt über eine Traktionswicklung (ca. 1460 kVA), eine Heizwicklung (1000-V-Zugheizung) und eine Hilfsbetriebswicklung (220 V). Die Traktionswicklung besitzt 15 Anzapfungen, die mit Hilfe elektro-pneumatischer Schütze und Drosselspulen 29 Fahrstufen ergeben. Die gesamte Hochspannungs- und Fahrsteuerung greift auf bereits normalisierte SBB-Komponenten der damals modernen Ae 6/6, RBe 4/4 und Re 4/4 II zurück.
| Technische Daten – SBB RABDe 12/12 |
| Bezeichnung | RABDe 12/12 |
| Nummernkreis | 1101–1120 |
| Inbetriebnahme | ab 1966 |
| Einsatz | Goldküste (Zürich-Meilen-Rapperswil) |
| Spurweite | 1 435 mm |
| Länge über Kupplung | ca. 73,3 m |
| Dienstgewicht | ca. 170 t |
| Achsanordnung | Bo’Bo’ + Bo’Bo’ + Bo’Bo’ |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Leistung / Beschleunigung | Stundenleistung ca. 3 300 PS; Beschleunigung anfänglich 1,2 m/s², später 0,7–0,8 m/s² |
| Stromsystem | 15 kV / 16,7 Hz AC, ein Stromabnehmer |
| Antrieb | 12 Motoren, Brown-Boveri-Federantrieb, Hohlwelle, 29 Fahrstufen (Hüpfersteuerung) |
| Bremsen | E-Bremse, automatische Bremse, EP-Bremse, mechanische Handbremse |
| Plätze | 200 Sitzplätze, 2. Klasse in beiden Endwagen, 1. Klasse im Mittelwagen |
Automatische Geschwindigkeitssteuerung
Für den vorgesehenen starren Fahrplan mit dichten Halteabständen und knapp bemessenen Reserven wäre eine rein manuelle Stufensteuerung kaum praktikabel gewesen. Die Lokführer hätten für jede Fahrt ständig Fahrstufen aufschalten, wieder zurücknehmen, rekuperativ bremsen und gleichzeitig die zulässigen Motorströme im Blick behalten müssen – alle zwei Minuten, den ganzen Tag. Die SBB entschieden sich daher für eine für die damalige Zeit sehr fortschrittliche Lösung: eine weitgehend elektronische automatische Geschwindigkeitssteuerung.
Der Lokführer stellt am Fahrschalter nur die Sollgeschwindigkeit ein. Die Elektronik misst mit einem Tachogenerator die Ist-Geschwindigkeit und vergleicht beide Werte. Daraus wird eine Stellgrösse gebildet, die als „Referenz“ auf die Steuerung wirkt. Im Fahrbetrieb werden die Fahrstufen so auf- oder abgeschaltet, dass der Motorstrom im zulässigen Rahmen bleibt und sich die Zugbeschleunigung angenehm weich anfühlt. Erreicht der Zug die Sollgeschwindigkeit, reduziert die Steuerung den Zugkraftbefehl auf ein Niveau, das die Geschwindigkeit hält.
Wird gebremst, arbeitet das System in umgekehrter Richtung: Es steuert zunächst die Rekuperationsbremse an und ergänzt bei Bedarf die pneumatische Bremse. Gleichzeitig überwacht es die Spannung an den Bremskondensatoren und verhindert Überspannungen.
Betriebserfahrungen
Die ersten auslieferungsreifen RABDe 12/12 wurden zunächst auf der Strecke Bern–Romont in einem speziellen Versuchsfahrplan erprobt. So konnten Laufverhalten, Bremsverhalten, elektrische Ausrüstung und Steuerung in der Praxis überprüft und nachjustiert werden. Auf Ende Mai 1966 wurden drei, mit dem Fahrplanwechsel im September desselben Jahres drei weitere Züge auf der rechtsufrigen Zürichseelinie in den regulären Verkehr eingegliedert. Bald wurde knapp die Hälfte der Züge auf dieser Strecke mit den neuen Vororttriebzügen gefahren.
Der Effekt war deutlich spürbar: Viele chronische Verspätungen verschwanden, da die neuen Züge ihre Fahrzeiten zuverlässig einhalten konnten und die Wendezeiten dank der Führerstandswechsel von nur neun Minuten sehr kurz waren.
Wie bei jedem neuen Fahrzeug traten anfänglich „Kinderkrankheiten“ auf. Ein Konstruktionsdetail an den Achslagern führte gleich am ersten Betriebstag zu einer Panne: Der äussere Ring eines Pendelrollenlagers konnte sich im Achslagergehäuse verschieben, so dass sich drehende und stehende Teile einander berühren konnten. Die Folge waren Warmläufer, allerdings ohne grössere Folgeschäden. Die Problematik wurde konstruktiv behoben.
Auch die erwähnten K-Bremssohlen zeigten bei nasser Witterung gewisse Nebenwirkungen an den Bandagen, insbesondere an Achsen mit Handbremswirkung. Daneben waren die üblichen Anpassungen an der Elektronik nötig, die sich aber im Rahmen hielten.
Schon in den ersten Kontrollfahrten überzeugte die automatische Geschwindigkeitssteuerung durch eine sehr feine Abstufung beim Anfahren und Bremsen und eine Genauigkeit bei der Einhaltung der Sollgeschwindigkeit im Bereich weniger km/h. Die Rekuperationsbremse zeigte sich stabil und unempfindlich gegenüber Selbsterregung; die geforderte Bremskraft von rund 16 Tonnen zwischen 30 und 100 km/h wurde gut eingehalten.
Die hohe Anfahrleistung führte allerdings dazu, dass die Unterwerke und die Fahrleitungsanlage an der Zürichseebahn verstärkt werden mussten. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten wurden die Züge mit einer Primärstrombegrenzung gefahren – die elektronische Steuerung liess sich entsprechend so einstellen, dass diese Begrenzung elegant und ohne Komforteinbussen umgesetzt wurde.
Insgesamt markierten die RABDe 12/12 einen wichtigen Schritt in Richtung modernen S-Bahn-Verkehr: durchdachtes Betriebskonzept, speziell darauf abgestimmtes Rollmaterial, hohes Beschleunigungsvermögen, leistungsfähige Rekuperationsbremse und eine für die Zeit sehr fortschrittliche automatische Steuerung. Sie waren gewissermassen die „Prototypen“ jener elektrisch angetriebenen Vororts- und S-Bahnzüge, die später zum Standard in vielen Grossräumen wurden. Die Hüpfersteuerung der Züge war zwar modern, jedoch waren die Stufensprünge gut spürbar. Mangels Vergleich mit stufenlos geregelten Fahrzeugen fiel das kaum negativ auf und die Reisenden gewöhnten sich rasch an das „Ruckeln“. Hätte der RABDe 12/12 – wie später andere S-Bahnfahrzeuge – bereits über eine stufenlose leistungselektronische Steuerung verfügt, wären diese Züge wohl (fast) perfekt gewesen.
Verbleib: Alle Fahrzeuge wurden zwischen 1995 und 1997 abgebrochen. Einzig ein Führerstand des Zuges 1116 ist noch vorhanden.

Zwei RABDe 12/12 in Doppeltraktion bei der Einfahrt in Zürich HB 1985 Bild Peter Alder WikiCommons